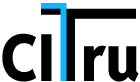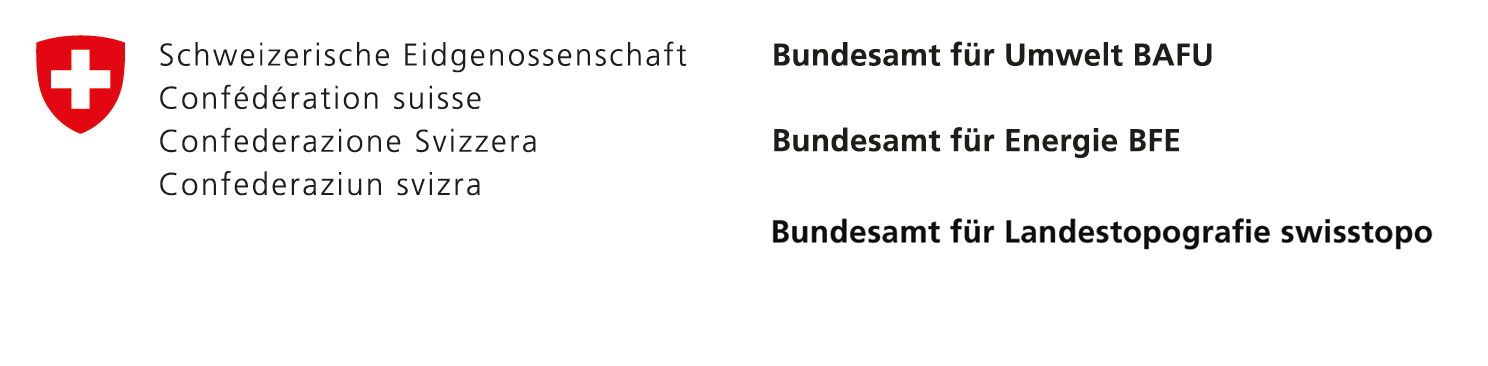Allgemeine Fragen zu CITru
In der Schweiz gibt es nur wenige Bohrlöcher, die so tief in den Untergrund reichen und für die Speicherung von CO2 geeignete Schichten durchdringen. Die stillgelegte Sondierbohrung der Nagra erfüllt diese Anforderungen und ist zudem in sehr guten Zustand. Für das Projekt bedeutet dies sowohl eine Kosten- als auch eine Zeitersparnis. Sie bietet damit eine einmalige Gelegenheit für einen Test, wie es mit CITru vorgesehen ist.
In Trüllikon handelt es sich um eine Testinjektion, wozu nur wenig CO2 eingespeist würde. Wie viel genau, ist derzeit noch in Abklärung. Es wird aber nur ein Bruchteil dessen sein, was bei kommerziellen Projekten für die permanente Speicherung von CO2 eingespeist wird. Ein laufendes kommerzielles Projekt in Norwegen wird bis zu 5 Millionen Tonnen CO2 jährlich einspeisen. In Trüllikon wird aktuell mit einer Grössenordnung von 10'000 Tonnen CO2 gerechnet.
Das CO2 würde in flüssiger Form mit Lastwagen angeliefert und voraussichtlich am Bohrplatz in einem Tank zwischengelagert. Durch die Bohrung würde das CO2 anschliessend in die durchlässige Gesteinsschicht in >1000 Meter Tiefe eingepresst, wo es sich langsam mit dem dort vorhandenen salzhaltigen Grundwasser auflöst. Letzteres eignet kann nicht als Trinkwasser verwendet werden. Das CO2 bleibt in diesem salzhaltigen Grundwasser gebunden, wie die Kohlensäure im Mineralwasser.
Wie viele Lastwagenfahrten für die CO2-Lieferung zum Bohrloch benötigt werden, hängt vor allem von der Menge an CO2 ab, die eingespeist werden soll und davon, wie viel CO2 über einen bestimmten Zeitraum eingespeist werden kann. Pro Fahrt können ungefähr 20 Tonnen CO2 transportiert werden. Wir evaluieren in der aktuellen Erkundungsphase die Auswirkungen von unterschiedlichen Mengen an CO2 unter anderem in Bezug auf die Sicherheit, Machbarkeit, Ausbildung des Reservoirs sowie Logistik.
Ein Entweichen des CO2 an die Erdoberfläche über die verschiedenen geologischen Schichten hinweg ist äusserst unwahrscheinlich, insbesondere aufgrund der mehreren Lagen an dichten Deckgesteinen oberhalb der Speicherschicht, die als natürliche Barriere dienen. Schon zahlreiche Projekte weltweit und auch Studien in der Schweiz im Felslabor Mont Terri (JU) haben nachgewiesen, dass flüssiges CO2 nicht einfach durch die Deckschichten aufsteigen kann.
Während der Erkundungsphase wird mittels verschiedener Messungen der lokale Untergrund sehr genau auf allfällige grössere Störzonen untersucht, die möglicherweise undicht sind. Käme es zu einer Einspeisung, würde die Ausbreitung des injizierten CO2 im Untergrund ebenfalls genaustens überwacht. Sollten sich in diesem Fall irgendwelche Unregelmässigkeiten zeigen, würde die Einspeisung gemäss vordefinierten Sicherheitsprotokollen pausiert oder abgebrochen.
Für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass CO2 an der Erdoberfläche entweicht, wäre dies nur in sehr kleinen Konzentrationen zu erwarten. Wenn CO2 entweichen könnte, dann nur sehr langsam, da es über 1000 Meter mächtige Schichten wandern müsste. Zudem wäre dies nur entlang von Verwerfungen möglich.
Das CO2 würde dann in die Atmosphäre entweichen und die Einspeisung hätte keinen positiven Effekt mehr auf die Klimabilanz. Eine Gefährdung von Menschen und Tieren schliessen wir in diesem Fall aufgrund der sehr geringen CO2-Konzentration aus. Eine explosionsartige Freisetzung von grösseren Mengen CO2 durch die Erdkruste ist extrem unwahrscheinlich.
Eine potenzielle Gefahr bestünde, wenn CO2 aufgrund eines Defekts oder einer Fehlbedienung bei der Einspeisung durch die Bohrung zurück an die Oberfläche entweichen würde. In diesem Fall könnten Menschen, die direkt am Bohrkopf arbeiten, verletzt werden. Solche und andere Arbeitsrisiken sollen durch die Anwendung von erprobten Verfahren und erfahrenen Mitarbeitenden weitgehend ausgeschlossen werden. Für die Umwelt bestünde in diesem Fall jedoch keine Gefahr, da das CO2 lediglich in die Atmosphäre entweichen würde.
Erdbeben können theoretisch durch die Deckschichten brechen und diese versetzen bzw. deren Durchlässigkeit erhöhen. Aus den folgenden zwei Gründen ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass CO2 durch solche Brüche langsam an die Oberfläche entweichen kann: Erstens müsste ein Bruch durchgehend auf einer Länge von mehr als einem Kilometer erfolgen, was extrem unwahrscheinlich ist und bislang noch nie in einem derartigen CO2-Speicherprojekt beobachtet wurde. Zweitens verheilen solche Brüche in den Schichten wieder. Also auch wenn sich über die Jahrhunderte mehrere Beben ereignen, die kleine Brüche erzeugen, ist es insbesondere bei den sehr kleinen Mengen CO2, die wir einzuspeisen planen, extrem unwahrscheinlich, dass sich das CO2 aufgrund von Erdbeben einen Weg durch die Deckschichten bahnen und so langsam entweichen könnte.
Hintergrund
Mit der Annahme des Klima- und Innovationsgesetzes 2023 hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, bis 2050 das Ziel von Netto-Null Treibhausgasemissionen zu erreichen. Das heisst: Im Jahr 2050 sollen nicht mehr Treibhausgase ausgestossen werden, als aus der Atmosphäre entfernt werden können. Die wichtigste Massnahme besteht darin, Treibhausgasemissionen weitmöglichst zu vermeiden oder zu reduzieren. In bestimmten Sektoren wie der Kehrichtverbrennung, der Zementherstellung oder der Landwirtschaft lässt sich eine vollständige Reduktion von CO2 aber kaum bewerkstelligen. Ihre Emissionen gelten daher als schwer vermeidbar und müssen durch CO2-Entnahme und -Speicherung und Negativemissionstechnologien (NET) angegangen werden.
Vorgesehen wären ab 2050 jährlich die Speicherung von 7 Mio. Tonnen im Untergrund, wobei diese im In- oder Ausland erfolgen kann.
Gemäss den Energieperspektiven 2050+ des Bundesamts für Energie belaufen sich die schwer vermeidbaren Emissionen aus Industrie, Abfallverwertung und Landwirtschaft im Jahr 2050 auf rund 12 Mio. Tonnen CO2 jährlich. Davon könnten rund 7 Mio. Tonnen CO2 aus Anlagen in der Schweiz mit CO2-Abscheidung und Speicherung im In- und Ausland vermieden oder im Falle von biogenen Emissionen durch Negativemissionen ausgeglichen werden. Die übrigen knapp 5. Mio. Tonnen CO2 müssen durch Negativemissionstechnologien voraussichtlich im Ausland aus der Atmosphäre entfernt werden.
Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze: CO2 lässt sich in basaltischem Gestein speichern, wo es relativ schnell mineralisiert, d.h. sich mit dem umgebenden Gestein verbindet. Alternativ lässt es sich in porösen, salzwasserführenden Sedimentgesteinen speichern, die durch eine undurchlässige Deckschicht gegen oben abgedichtet werden oder in erschöpften Öl- und Gasreservoirs. In der Schweiz gibt es keine geeigneten basaltischen Gesteine, weshalb nur der zweite Ansatz geprüft werden kann. Dafür geeignete Schichten sind in der Schweiz in einer Tiefe von ungefähr 800 Metern oder mehr zu finden. In Trüllikon befindet sich die relevante Speicherschicht in einer Tiefe von mehr als einem Kilometer und wird von dichten Deckschichten überlagert.
Die Risiken im Zusammenhang mit der unterirdischen Speicherung von CO2 hängen von der gewählten geologischen Formation und dem Verfahren ab. Bislang wurde die CO2-Speicherung in grösserem Massstab in tiefen salinen Aquiferen oder stillgelegten Öl- und Gasreservoirs durchgeführt. Künstliche CO2-Speicher sind also Kopien von natürlichen Erdgaslagerstätten. Derzeit sind weltweit etwa 30 Projekte in Betrieb, bei denen CO2 in solchen Formationen gespeichert wird und etwa 100 weitere Projekte sind in Planung. Diese erfolgreichen Projekte zeigen, dass eine sorgfältig konzipierte und betriebene unterirdische CO2-Speicherung sicher ist. Jedes Projekt erfordert jedoch eine detaillierte und projektspezifische Risikobewertung. Zwei der Risiken, die bei Projekten zur Speicherung in Aquiferen sorgfältig bewertet werden müssen, sind das Risiko eines Entweichens von CO2 durch Lecks in der geologischen Formation oder bestehenden Bohrlöcher sowie das Risiko induzierter Seismizität und/oder einer Oberflächenverformung.
Induzierte Erdbeben wurden als Folge von Öl- und Gasförderungen, geothermischer Projekte, des Bergbaus oder in Zusammenhang mit Staudämmen beobachtet.
In CITru besteht aufgrund der kleinen Speichermenge an CO2 ein sehr geringes Risiko, dass die CO2-Einspeisung kleinere Erdbeben auslöst. Zudem wird die Einspeisung in Echtzeit überwacht. Dies ermöglicht die Einspeisung bei Bedarf anzupassen oder anzuhalten.
Das salzige Wasser in der über einen Kilometer tief liegenden Schicht, in welche das CO2 eingespeist wird, wird nicht als Trinkwasser verwendet. Trinkwasser fliesst nur in oberflächen-nahen Gesteinsschichten. Zwischen der Trinkwasserschicht und der Einspeiseschicht liegen mehrere dichte Deckschichten, welche das CO2 am Aufsteigen hindern. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass CO2 in die Trinkwasserschicht gelangt. Mögliche Risiken, wie beispielsweise Durchlässigkeiten entlang des Bohrlochs, werden genau abgeklärt und abgesichert.